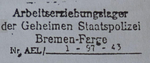Michaelskirche (Neuenkirchen)
BacksteinkircheBarockbauwerk in NiedersachsenBarockisierte KircheBaudenkmal in SchwanewedeBauwerk der Romanik in Niedersachsen ... und 11 mehr
Bauwerk in SchwanewedeErbaut im 19. JahrhundertErbaut in den 1190er JahrenErbaut in den 1760er JahrenFeldsteinkircheKirchengebäude der Evangelisch-reformierten Kirche (Landeskirche)Kirchengebäude im Landkreis OsterholzKirchengebäude in EuropaMichaeliskircheRomanische KircheSaalkirche in Niedersachsen

Die teils romanische Michaelskirche (St. Michael) an der Landstraße 71 in der niedersächsischen Gemeinde Schwanewede, Ortsteil Neuenkirchen, stammt aus dem 12. und 18. Jahrhundert. Das Gebäude und der Friedhof nebst Einfriedigung stehen unter Denkmalschutz (siehe auch Liste der Baudenkmale in Schwanewede). Die Kirche ist nach dem Erzengel Michael benannt.
Auszug des Wikipedia-Artikels Michaelskirche (Neuenkirchen) (Lizenz: CC BY-SA 3.0, Autoren, Bildmaterial).Michaelskirche (Neuenkirchen)
Landstraße,
Geographische Koordinaten (GPS) Adresse Weblinks In der Umgebung Auf Karte anzeigen
Geographische Koordinaten (GPS)
| Breitengrad | Längengrad |
|---|---|
| N 53.234772 ° | E 8.514256 ° |
Adresse
St.-Michael Kirche (Sankt Michaelskirche;Michaels-Kirche;St. Michaels-Kirche)
Landstraße
28790
Niedersachsen, Deutschland
Bei Google Maps öffnen