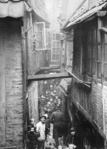Laeiszhalle
Bauwerk im Bezirk Hamburg-MitteDisposition einer OrgelErbaut in den 1900er JahrenKonzerthaus in DeutschlandKulturdenkmal in Hamburg-Neustadt ... und 3 mehr
Laeisz (Familie)Neobarockes Bauwerk in HamburgSpielstätte für Musik (Hamburg)

Die Laeiszhalle (sprich: „Laißhalle“), ehem. Musikhalle Hamburg, ist ein traditionsreiches Konzerthaus am Johannes-Brahms-Platz in Hamburg. Sie wurde in neobarockem Stil errichtet und 1908 eingeweiht. Ihr Großer Saal bietet 2025 Sitzplätze und eine Orgel. Der Kleine Saal hat 640 Sitzplätze.Generalintendant der Laeiszhalle ist seit 2007 Christoph Lieben-Seutter. Er ist auch für die am 11. Januar 2017 eröffnete Elbphilharmonie zuständig. Die Symphoniker Hamburg sind das Orchester der Laeiszhalle.
Auszug des Wikipedia-Artikels Laeiszhalle (Lizenz: CC BY-SA 3.0, Autoren, Bildmaterial).Laeiszhalle
Gorch-Fock-Wall, Hamburg Neustadt
Geographische Koordinaten (GPS) Adresse Telefonnummer Webseite Weblinks In der Umgebung Auf Karte anzeigen
Geographische Koordinaten (GPS)
| Breitengrad | Längengrad |
|---|---|
| N 53.555833333333 ° | E 9.9808333333333 ° |
Adresse
Laeiszhalle Musikhalle Hamburg
Gorch-Fock-Wall
20355 Hamburg, Neustadt
Deutschland
Bei Google Maps öffnen