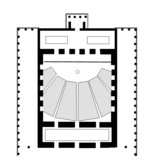Areopag

Der Areopag, auch Areiopag(os), (von altgriechisch Ἄρειος πάγος Áreios págos, deutsch ‚Aresfels bzw. -hügel‘) ist ein nordwestlich der Akropolis gelegener, 115 Meter hoher Felsen mitten in Athen. In der Antike tagte hier der oberste Rat, der gleichfalls „Areopag“ genannt wurde. Der Rat war die älteste Körperschaft der Stadt; seine Geschichte reicht bis in die mythische Frühzeit Athens zurück. Auch hat die Ursprungslegende des Marathonlaufes ihren Höhepunkt auf dem Areopag: Nachdem die Athener bei der Schlacht bei Marathon über die Perser gesiegt hatten, soll ein Bote von Marathon nach Athen gelaufen und nach der Verkündung des Sieges auf dem Gipfel des Hügels gestorben sein. Historisch ist diese Darstellung jedoch umstritten und wird daher in der Regel als Legende eingestuft.
Auszug des Wikipedia-Artikels Areopag (Lizenz: CC BY-SA 3.0, Autoren, Bildmaterial).Areopag
Θεωρίας, Athen Άνω Πετράλωνα (3η Κοινότητα Αθηνών)
Geographische Koordinaten (GPS) Adresse In der Umgebung Auf Karte anzeigen
Geographische Koordinaten (GPS)
| Breitengrad | Längengrad |
|---|---|
| N 37.972222222222 ° | E 23.723611111111 ° |
Adresse
Άρειος Πάγος
Θεωρίας
105 55 Athen, Άνω Πετράλωνα (3η Κοινότητα Αθηνών)
Attika, Griechenland
Bei Google Maps öffnen